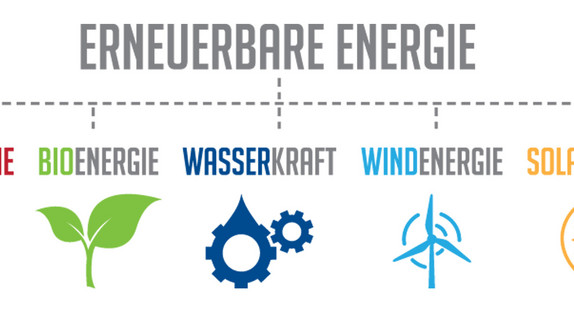Seit dem 1. Januar 2024 gelten die neuen Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) des Bundes zum erneuerbaren Heizen. In Baden-Württemberg gilt, für Gebäude, die am 1. Januar 2009 bereits errichtet waren, auch weiterhin das Erneuerbare-Wärme-Gesetz des Landes. Das wirft Fragen auf: Welche Heizungen sind zukünftig im Neubau erlaubt und welche im Bestand? Welche Übergangsfristen sieht das Gebäudeenergiegesetz vor? Wie ist das Verhältnis von Gebäudeenergiegesetz (GEG) und Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG)? Wir haben Antworten auf wichtige Fragen zum Thema Heizen für Sie zusammengestellt.
Ab dem 1. Januar 2024 dürfen in Neubauten innerhalb von Neubaugebieten nach Paragraf 71 des novellierten Gebäudeenergiegesetzes (GEG) Heizungsanlagen nur eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie mindestens 65 Prozent der Wärme mit erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme erzeugen. Die Wärmeplanung spielt in diesen Fällen keine Rolle.
Für Neubauten, die in Baulücken errichtet werden, gelten folgende Fristen:
- In Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern greift diese Regelung ab dem 1. Juli 2026.
- In Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern greift diese Regelung ab dem 1. Juli 2028.
Die Installation von Heizungen mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien wird bereits dann verbindlich,
- wenn ein Gebiet für den Neu- oder Ausbau eines Wärmenetzes oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet vor Mitte 2026 beziehungsweise Mitte 2028 ausgewiesen wird und
- wenn eine zusätzliche, zweite Entscheidung getroffen wurde, dass die fertige Wärmeplanung die Wirkungen des Gebäudeenergiegesetzes auslösen soll.
Diese zusätzliche Entscheidung durch die Gemeinde könnte nach derzeitiger Einschätzung des Umweltministeriums Baden-Württembergs zum Beispiel in Form einer kommunalen Satzung erfolgen. Das Gesetzgebungsverfahren, dass dies festlegt, wird voraussichtlich Anfang 2025 abgeschlossen sein.
Wichtig: Es geht nur um den Einbau oder das Aufstellen neuer Heizungen. Bereits eingebaute Heizungen können weiter betrieben und defekte Heizungen können weiterhin repariert werden.
Das Gebäudeenergiegesetz des Bundes und die Pflicht nach einem Heizungstausch mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien zu nutzen, greift für den Bestand ab 1. Juli 2026 in Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern beziehungsweise 1. Juli 2028 in Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern.
Diese Frist kann jede Gemeinde individuell vorverlegen, wenn sie die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen hat und sie eine zusätzliche, zweite Entscheidung trifft, wonach die fertige Wärmeplanung die Wirkungen des Gebäudeenergiegesetzes auslösen soll
Solange diese nicht getroffen wurde, gilt das Erneuerbare-Wärme-Gesetz des Landes (EWärmeG BW) für Bestandsgebäude, die am 1. Januar 2009 bereits errichtet waren, weiterhin. Die landesrechtliche Regelung gilt seit 2008 und bleibt weiterhin bestehen, sodass nach einem Heizungstausch in Bestandsgebäuden mindestens 15 Prozent erneuerbare Wärme genutzt oder Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Damit wird die im Land seit langem bestehende Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Wärme ohne Unterbrechung fortgeführt.
Dabei können mehrere technologische Möglichkeiten genutzt werden, wie beispielsweise der Anschluss an ein Wärmenetz, eine elektrische Wärmepumpe oder eine Pelletheizung. Das Gebäudeenergiegesetz sieht Übergangslösungen und mehrjährige Übergangsfristen vor.
Mit der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) wurde bei Bestandsgebäuden also keine neue sofortige Pflicht geschaffen, bestehende Heizungen auszutauschen. Unabhängig von der aktuellen Gebäudeenergiegesetz-Novelle gilt weiterhin die Regelung, dass Heizungen ausgetauscht werden müssen, die älter sind als 30 Jahre. Diese Regel galt auch bisher schon.
Auch die bislang geltenden Ausnahmen von der Austauschpflicht 30 Jahre alter Heizungen gelten weiterhin: Wenn es sich um einen Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel handelt oder die Nennleistung unter 4 Kilowatt oder über 400 Kilowatt liegt, gilt laut Paragraf 72 Absatz 3 Gebäudeenergiegesetz die Austauschregel nach 30 Jahren nicht. Hier wurde jetzt neu die Möglichkeit geschaffen, solche alten Heizungen als Bestandteil einer Hybridheizung weiter zu nutzen, solange sie nicht mit fossilen Brennstoffen betrieben werden.
Da die CO2-Preise über die Zeit voraussichtlich teurer werden, sollte jedoch, bereits in den Übergangsphasen die Umstellung auf eine klimafreundliche Heizung mit Erneuerbaren Energien geprüft werden.
Die Erfüllungsoptionen des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes des Landes sind teilweise andere als die des Gebäudeenergiegesetzes: Beispielsweise sind ein Sanierungsfahrplan, baulicher Wärmeschutz, eine Photovoltaikanlage oder Kraft-Wärme-Kopplung Erfüllungsoptionen des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes des Landes, werden aber im Gebäudeenergiegesetz nicht zur (teilweisen) Erfüllung der 65 Prozent-Regel anerkannt.
Sollten Sie das Gebäudeenergiegesetz erfüllen, so entfällt die Nachweispflicht für das Erneuerbare-Wärme-Gesetz.
Deswegen folgender wichtiger Hinweis: Wenn Sie sich für eine neue Heizung entscheiden, dann prüfen Sie bitte, ob diese nicht nur kurzfristig das Erneuerbare-Wärme-Gesetz des Landes, sondern auch langfristig das Gebäudeenergiegesetz erfüllt. Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater, Ihrer regionalen Energieagentur vor Ort oder „Zukunft Altbau“ beraten.
Wenn Sie jetzt schon nach einem Heizungstausch freiwillig und dauerhaft 65 Prozent erneuerbare Wärme nach den Erfüllungsoptionen des Gebäudeenergiegesetz im Bestand nutzen, obwohl die Pflicht erst ab 1. Juli 2026/2028 greifen würde, dann ist damit bereits Paragraf 71 Absatz 1 Gebäudeenergiegesetz erfüllt. Daraus folgt, dass das Erneuerbare-Wärme-Gesetz als Landesrecht keine Anwendung mehr findet. Diese Systematik ergibt sich aus dem grundgesetzlichen Vorrang des Bundesrechts vor dem Landesrecht.
Sollten Sie das Gebäudeenergiegesetz erfüllen, so entfällt die Nachweispflicht für das Erneuerbare-Wärme-Gesetz.
Ja, dies ist möglich solange die Anforderungen an Biogas und Wasserstoff sowie deren Derivate erfüllt werden (Paragraf 71f Gebäudeenergiegesetz). Biogas kann als Erfüllungsoption des Gebäudeenergiegesetz aber nur anerkannt werden, wenn das Biogas auch tatsächlich vom Netzbetreiber eingespeist wird. Der Lieferant muss dem Endkunden bestätigen, dass bilanziell genauso viel Biomethan (Biogas) ins Erdgasnetz eingespeist wurde, wie an anderer Stelle von Endkunden entnommen wurde.
Die Verwendung von sogenanntem „Windgas“, „Klimagas“ oder von Gas, bei dem in Zertifikaten bestätigt wird, dass ein bestimmter finanzieller Anteil in „grüne“ Projekte oder entsprechende Forschungsprojekte fließt, werden nicht anerkannt.
Wenn Sie sich für eine neue Heizung entscheiden, die mit Biomethan/Biogas betrieben werden soll, tragen Sie das Risiko, falls Biogas nicht dauerhaft in der geforderten Menge verfügbar ist. In diesem Fall könnte die Heizung nicht rechtskonform betrieben werden.
Ja, das ist grundsätzlich möglich. Wenn Sie zwischen Januar 2024 und dem Zeitpunkt, ab dem das Gebäudeenergiegesetz „scharfgeschaltet“ wird (spätestens 30. Juni 2028) eine Öl- oder Gasheizung einbauen, müssen Sie
- ab 2029 15 Prozent Bioheizöl/Biogas/Wasserstoff verwenden,
- ab 2035 30 Prozent und
- ab 2040 60 Prozent.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Heizungsanlagen technisch dafür geeignet sind und fragen Sie dementsprechend bei ihrem Heizungsbauer oder Heizkesselhersteller nach.
Ab dem 1. Januar 2045 dürfen keine „fossilen“ Öl-/Gasheizungen mehr betrieben werden, Paragraf 72 Absatz 4 Gebäudeenergiegesetz.
Außerdem müssen Sie, in Gebäuden, die am 1. Januar 2009 bereits errichtet waren, nach baden-württembergischen Landesrecht (EWärmeG) nach einem Heizungstausch 15 Prozent Erneuerbare Wärme, also zum Beispiel Bioheizöl/Biogas oder andere Erfüllungsoptionen verwenden.
Weil die Erfüllungsoptionen des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes (Sanierungsfahrplan, baulicher Wärmeschutz, Photovoltaikanlage oder Kraft-Wärme-Kopplung und so weiter) teilweise unterschiedlich sind zu denen des Gebäudeenergiegesetzes, sind Sie – unabhängig von der gewählten Erfüllungsoption des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes – nach Gebäudeenergiegesetz verpflichtet, Bioheizöl/Biogas/Wasserstoff in den oben genannten zeitlichen Staffelungen zu verwenden.
Seit Januar 2024 müssen Sie sich vor dem Einbau einer neuen Öl-/Gasheizung beraten lassen hinsichtlich möglicher Auswirkungen der kommunalen Wärmeplanung und einer möglichen Unwirtschaftlichkeit der Anlage, insbesondere aufgrund ansteigender CO2-Bepreisung (Paragraf 71 Absatz 11 Gebäudeenergiegesetz). Der Bund stellt ein Informationsblatt [PDF] für diese verpflichtende Beratung zur Verfügung. Es enthält auch einen Vordruck, um diese zu bescheinigen. Wenn Sie sich für eine neue „fossile“ Heizung entscheiden, tragen Sie das Risiko, falls Bioheizöl/Biogas/Wasserstoff nicht dauerhaft in der geforderten Menge verfügbar ist. In diesem Fall könnte die Heizung nicht rechtskonform betrieben werden.
Ein kommunaler Wärmeplan bildet die Grundlage für eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Die Kommune legt fest, welche Gebiete wie mit Wärme versorgt werden und inwieweit erneuerbare Energien und Abwärme dabei genutzt werden können.
Die Wärmeplanung soll Bürgerinnen und Bürgern Planungs- und Investitionssicherheit geben und ihnen aufzeigen, welche Heiztechnologie für das jeweilige Gebäude am besten geeignet ist. Der Wärmeplan soll Anreize für notwendige Investitionen in eine Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien und die Nutzung unvermeidbarer Abwärme schaffen. Je früher der Wärmeplan beschlossen wird, umso besser für die Bürgerinnen und Bürger: So bekommen sie früh Planungssicherheit.
Der kommunale Wärmeplan ist nach dem Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW) ein informeller Plan ohne rechtliche Außenwirkung. Auch nach dem Wärmeplanungsgesetz des Bundes wird das so bleiben.
Allein das Vorlegen eines Wärmeplans durch eine Gemeinde löst nicht die Anwendung des Gebäudeenergiegesetzes aus. Hierzu bedarf es gemäß Paragraf 26 Wärmeplanungsgesetz einer zusätzlichen Entscheidung der Gemeinde zur Ausweisung von Gebieten zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder von Wasserstoffnetzausbaugebieten unter Berücksichtigung der Ergebnisse des kommunalen Wärmeplans.
Diese zusätzliche Entscheidung durch die Gemeinde könnte nach derzeitiger Einschätzung des Umweltministeriums Baden-Württemberg zum Beispiel in Form einer kommunalen Satzung erfolgen.
Erst mit dieser Entscheidung würde das Gebäudeenergiegesetz für Bestandsgebäude für die ausgewiesenen Gebiete aktiviert.
Das Gebäudeenergiegesetz ermöglicht die Nutzung beziehungsweise die Anerkennung zur Pflichterfüllung durch die Nutzung von sogenannten H2-ready-Heizungen. Im Übergangszeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum Inkrafttreten der 65 Prozent-Erneuerbare-Wärmenutzungspflicht nach dem Gebäudeenergiegesetz (spätestens bis 30. Juni 2028) müssen bei allen Gas- und Ölheizungen in gestaffelten Anteilen (15/30/60 Prozent) Bioheizöl, Biogas oder Wasserstoff genutzt werden.
Grüner Wasserstoff ist und bleibt eine knappe Ressource und wird voraussichtlich vorrangig der Industrie oder im Verkehr zur Verfügung stehen und nicht dem individuellen Heizbedarf.
Das Kompetenzzentrum Wärmewende bei der KEA-BW ist der erste Ansprechpartner in Baden-Württemberg für alle Fragen rund um die Wärmeplanung. Das Online-Angebot der KEA-BW umfasst Antworten auf häufig gestellte Fragen, weitere Informationsmaterialien, Materialien für die Ausschreibung und vieles weitere.
In Baden-Württemberg gibt es regionale Energieagenturen, die unter anderem Energieberatung für Hausbesitzer und Mieter, Beratung zu erneuerbaren Energien und Energiedienstleistungen anbieten.
Informationen zum Gebäudeenergiegesetz des Bundes
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz: Heizungswegweiser
Verbraucherzentrale: GEG – Was ändert sich mit dem Gebäude-Energie-Gesetz?
Die Bundesregierung: Gesetz für Erneuerbares Heizen – Für mehr klimafreundliche Heizungen
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz: Energiewechsel