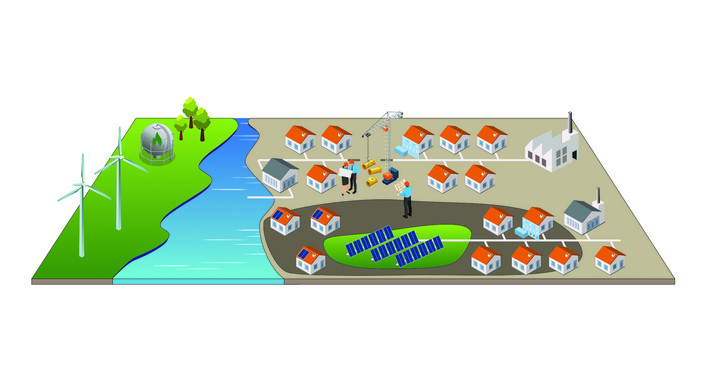Ein kommunaler Wärmeplan bildet die Grundlage zur Erreichung einer klimaneutralen Wärmeversorgung. Mit Hilfe dieses Fahrplans sollen die Gemeinden die richtigen Entscheidungen treffen. Er soll aber auch alle anderen lokalen Akteurinnen und Akteure und Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer bei ihren individuellen Investitionsentscheidungen unterstützen.
Die Wärmewende erfordert zunächst eine massive Reduzierung des Wärmebedarfs unserer Gebäude. Dennoch es ist offensichtlich, dass auch künftig noch erhebliche Mengen Energie für Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme eingesetzt werden müssen. Diese müssen wir nach und nach möglichst vollständig aus unterschiedlichen Quellen erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme decken, um den Gebäudebestand klimaneutral zu machen.
Da Wärme nicht so leicht transportierbar ist wie Strom, muss dieser Transformationsprozess unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort gestaltet werden. Dabei kommt den Gemeinden eine zentrale Rolle zu, die sie mit dem Prozess der Wärmeplanung erfüllen.
Jede Gemeinde entwickelt im kommunalen Wärmeplan ihren Weg zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung, der die jeweilige Situation vor Ort bestmöglich berücksichtigt. Ein solcher Plan ist immer in Prozesse eingebettet: Er dient als strategische Grundlage, um konkrete Entwicklungswege zu finden und die Kommune in puncto Wärmeversorgung zukunftsfähig zu machen. Dabei wird er auch zu einem wichtigen Werkzeug für eine nachhaltige Stadtentwicklung.
Eine Übersicht über den aktuellen Stand der kommunalen Wärmeplanungen in Baden-Württemberg und weitere Informationen zu den einzelnen Planungen finden Sie bei der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) im Energieatlas Baden-Württemberg.
Die vier Grundelemente eines kommunalen Wärmeplans
Erhebung des aktuellen Wärmebedarfs und -verbrauchs und der daraus resultierenden Treibhausgas-Emissionen, einschließlich Informationen zu den vorhandenen Gebäudetypen und den Baualtersklassen, der Versorgungsstruktur aus Gas- und Wärmenetzen, Heizzentralen und Speichern sowie Ermittlung der Beheizungsstruktur der Wohn- und Nichtwohngebäude.
Ermittlung der Potenziale zur Energieeinsparung für Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme in den Sektoren Haushalte, Gewerbe-Handel-Dienstleistungen, Industrie und öffentlichen Liegenschaften sowie Erhebung der lokal verfügbaren Potenziale erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme.
Entwicklung eines Szenarios zur Deckung des zukünftigen Wärmebedarfs mit erneuerbaren Energien zur Erreichung einer klimaneutralen Wärmeversorgung. Dazu gehört eine räumlich aufgelöste Beschreibung der dafür benötigten zukünftigen Versorgungsstruktur im Jahr 2040 mit Zwischenzielen. Dies erfolgt durch die Ermittlung und textliche und kartografische Darstellung von Eignungsgebieten für zentrale oder dezentrale Wärmeversorgung.
Formulierung eines Transformationspfads zur Umsetzung des kommunalen Wärmeplans, mit ausgearbeiteten Maßnahmen, Umsetzungsprioritäten und Zeitplan für die nächsten Jahre und einer Beschreibung möglicher Maßnahmen für die Erreichung der erforderlichen Energieeinsparung und den Aufbau der zukünftigen Energieversorgungsstruktur.
Der Prozess der kommunalen Wärmeplanung führt Potenziale und Bedarf systematisch zusammen. Auf diese Weise lassen sich Einsatzmöglichkeiten der Energiequellen im künftigen Energiesystem definieren und lokal umsetzen. Bei der nachfolgenden Einbindung des kommunalen Wärmeplans in die weiteren kommunalen Planungsaufgaben sollten die Beteiligten der Wärme- und Stadtplanung sich regelmäßig abstimmen.
Ein kommunaler Wärmeplan wirkt dabei als Routenplaner. Denn seine Ergebnisse und Handlungsvorschläge dienen dem Gemeinderat und den Ausführenden als Grundlage für die weitere Stadt- und Energieplanung. Während des gesamten Prozesses gilt es, die Inhalte anderer Vorhaben der Gemeinde, etwa die der Bauleit- oder Regionalplanung, zu berücksichtigen.
Im Jahr 2020 verpflichtete das Land als bundesweiter Vorreiter die Stadtkreise und Großen Kreisstädte mit Paragraf 27 des Klimagesetzes Baden-Württemberg dazu, bis zum 31. Dezember 2023 einen kommunalen Wärmeplan zu erstellen und beim zuständigen Regierungspräsidium einzureichen. Dadurch entstanden Wärmepläne für über die Hälfte der Bevölkerung Baden-Württembergs. Zudem wurden zahlreiche kleinere Gemeinden bei ihrer freiwilligen Wärmeplanung vom Umweltministerium gefördert.
Im Jahr 2024 wurde vom Bund das Wärmeplanungsgesetz erlassen. Dieses Gesetz enthält im Vergleich zu den bisherigen Regelungen im Klimagesetz Baden-Württemberg – bei grundsätzlicher Beibehaltung der Planungslogik und des Planungsablaufs – detailliertere Regelungen für die Wärmeplanung.
Die Verpflichtung zur Wärmeplanung betrifft nun alle Gemeinden unabhängig von deren Einwohnerzahl, nicht nur die Stadtkreise und Großen Kreisstädte. Für Gemeinden bis zu 100.000 Einwohnern sind die Wärmepläne bis spätestens 30. Juni 2028 zu erstellen.
Das Wärmeplanungsgesetz enthält zusätzlich zu den Regelungen über Ablauf und Inhalt der Wärmeplanung verbindliche Vorgaben für die Betreiber von bestehenden und neuen Wärmenetzen zur schrittweisen Dekarbonisierung ihrer Netze, die es bisher weder im Bundes- noch im Landesrecht gab.
Gemäß Paragraf 5 Absatz 1 des Wärmeplanungsgesetzes wird die Wirksamkeit eines nach den bisherigen landesrechtlichen Regelungen erstellten und in Erstellung befindlichen Wärmeplans durch das Inkrafttreten des Bundesgesetzes nicht berührt, er genießt also Bestandsschutz.
Das Wärmeplanungsgesetz findet dann Anwendung, wenn der Beschluss über die Durchführung der Wärmeplanung nach dem 6. August 2025 gefasst wurde, außerdem für die Fortschreibung aller Wärmepläne. Die durch das Änderungsgesetz vom 29. Juli 2025 neu eingefügten Paragrafen 27a ff. des Klimagesetzes Baden-Württemberg regeln die Einzelheiten der Umsetzung des Wärmeplanungsgesetzes im Land. Im Zuge dieser Umsetzung hat das Land die vom Bundesgesetz eingeräumte Möglichkeit genutzt, gemeinsame Wärmeplanungen (sogenannte Konvois) für alle Gemeinden zuzulassen und für Gemeinden, in denen zum 1. Januar 2024 weniger als 10.000 Einwohner gemeldet waren, ein vereinfachtes Verfahren zur Verfügung zu stellen.
Aufgrund des vom Wärmeplanungsgesetz gewährten Bestandsschutzes wird es in Baden-Württemberg einige Zeit zwei Typen von Wärmeplänen geben: Erstens fertiggestellte und bis zum 6. August 2025 bereits begonnene Wärmeplanungen, die noch nach den bisherigen Regelungen im Klimagesetz Baden-Württemberg ohne Geltung des Wärmeplanungsgesetzes fertiggestellt werden und zweitens nach diesem Zeitpunkt neu begonnene Wärmeplanungen, für die das Wärmeplanungsgesetz und die neuen ergänzenden Landesregelungen aufgrund des Änderungsgesetzes vom 29. Juli 2025 gelten. Erst die Fortschreibung der Wärmepläne erfolgt dann einheitlich nach den Vorgaben des Wärmeplanungsgesetzes mit den ergänzenden Landesregelungen nach KlimaG BW.
Der Gesetzentwurf der Landesregierung in der Landtagsdrucksache 17/9005 vom 24. Juni 2025 enthält ab Seite 48 detaillierte Einzelbegründungen zu allen neuen Regelungen des Klimagesetzes Baden-Württemberg, die die Umsetzung des Wärmeplanungsgesetzes betreffen.
Über das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmwende (KWW) in Halle stellt der Bund zahlreiche Informationen und Unterstützungsangebote zum Wärmeplanungsgesetz bereit, darunter insbesondere einen umfassenden „Leitfaden Wärmeplanung“ und einen sogenannten Technikkatalog mit erläuterndem Begleitdokument.
Informationen, Beratung und Unterstützung erhalten die Gemeinden auch durch das Kompetenzzentrum Wärmewende der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) und das flächendeckende Angebot der regionalen Beratungsstellen zur Unterstützung der kommunalen Wärmeplanung. Auf das umfangreiche, praxisorientierte Informationsportal der KEA-BW sowie auf den Energieatlas Baden-Württemberg, die Datenplattform bei der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, wird besonders hingewiesen.
Insbesondere die downloadbaren Wärmebedarfsdaten im Energieatlas sind sehr hilfreich, um einen schnellen Überblick zu bekommen, wo im Gemeindegebiet gegebenenfalls Wärmenetze realisierbar sein könnten und wo eher dezentrale Lösungen zum Zuge kommen könnten.
Weitere Informationen
Fragen und Antworten zur kommunalen Wärmeplanung Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Häufig gestellte Fragen Wärmeplanung – Wärmeplanungsgesetz (WPG) Landtag von Baden-Württemberg: Gesetzentwurf der Landesregierung, Landtagsdrucksache 17/9005 vom 24. Juni 2025 Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW): Informationen zum novellierten KlimaG BW Kompetenzzentrum Wärmewende der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) Energieatlas Baden-Württemberg Kompetenzzentrum Kommunale Wärmwende (KWW) in Halle